Basic HTML-Version

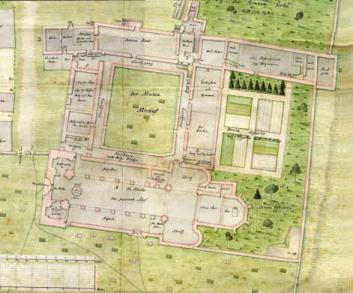
29
Zu den Baulichkeiten der Klosteranlage liefern die Urkunden
und sonstigen archivalischen Schriftquellen für die ersten
etwa 450 Jahre der Entwicklungsgeschichte nur recht
spärliche Hinweise.
1
Dies betrifft sowohl den spätromanisch-
frühgotischen Ursprungsbau des ausgehenden 12. / frühen
13. Jahrhunderts sowie die nachfolgenden spätmittelalter-
lichen und neuzeitlichen Veränderungen im 14.–17. Jahr-
hundert. So sind in den Urkunden nach P. J. Meier
2
lediglich
die folgenden Räumlichkeiten erwähnt: im Jahre 1274 der
Kapitelsaal, 1315 der Remter (der Speisesaal, Refektorium),
1331 der Schlafsaal (Dormitorium), 1462 der Kreuzgang
und 1488 das „locutorium minus“ (ein kleines Sprech
zimmer, Parlatorium). Die etwa bis in die Mitte des 17.
Jahrhunderts an den Klausurgebäuden durchgeführten
baulichen Veränderungen lassen sich im Wesentlichen nur
noch durch eine Betrachtung und Interpretation der Bau-
spuren vor Ort nachvollziehen und sind abhängig vom
jeweiligen Umfang der jüngeren Veränderungen. Dabei
lässt sich erkennen, dass die spätmittelalterlichen und
frühneuzeitlichen Raumzuschnitte durch die barocken Ver-
änderungen des 18. Jahrhunderts in der Regel lediglich
unterschiedlich stark überformt wurden. Durch den Einbau
zusätzlicher Wände oder auch ganzer Raumgefüge bis hin
zu Aufstockungen einzelner Gebäudeteile wurden sie den
veränderten Nutzungen und Nutzerbedürfnissen entspre-
chend neu strukturiert. Im Unterschied zu den späteren
Eingriffen des 19. und 20. Jahrhunderts wurde dabei
vergleichsweise wenig ältere Bausubstanz durch einen
vollständigen Abbruch und/oder teilweisen Neuaufbau
zerstört.
Gegen Ende des 18. Jahrhunderts (Abb. 1) liefern auch
Bestands- oder Umbaupläne des Vermessers Johann Martin
Schüttelöffel erste konkrete Aufschlüsse zu den derzeitigen
Baustrukturen und Nutzungen der einzelnen Klausurflügel.
Die Bestandspläne stellen angesichts der umfangreichen
späteren Veränderungen im 19. Jahrhundert, insbesondere
unter der Domina Charlotte von Veltheim nach 1860, eine
wichtige archivalische Grundlage zur Erschließung der älte
ren Raum- und Nutzungsstrukturen der Klosteranlage dar.
Die jeweils aufwendig kolorierten Bestands- und Umbau-
pläne dokumentieren nach derzeitiger Kenntnis zum einen
die älteste vollständige Darstellung zum Grundrissgefüge
des gesamten Klosterareals und umfassen darüber hinaus
auch noch Einzelaufnahmen in besonders detaillierter
Ausführung für alle Grundrissebenen der Klausurgebäude
Was uns die Steine erzählen –
Raumstruktur und Nutzung der Klausurgebäude im Wandel der Zeit
Dieter Haupt
und des Kirchenbaues. Zudem liefern die relativ ausführlichen
Planbeschriftungen und Legenden eindeutige Informationen
zu den damaligen Raumnutzungen und den unterschied-
lichen Höhenlagen der jeweiligen Flügelbereiche. Beson-
ders interessant sind hier auch einzelne Hinweise auf ältere
Nutzungen an gleicher Stelle, die zumindest teilweise auf
den bauzeitlichen Bestand der mittelalterlichen Kloster
anlage zurückgehen könnten. Beispiele hierfür sind der
große mittlere Raumbereich im Erdgeschoss des Nordost-
flügels mit der Raumbezeichnung
Holz-Remise für die
Domina, olim
[einst]
Refectorium
und der nördliche Raum-
bereich im Erdgeschoss des Westflügels mit der Bezeich-
nung
Des Försters Heu und Holtzstall. Olim die Schule
.
Diese Pläne bilden die Basis und eine eindeutige Anknüp-
fungsmöglichkeit für eine erste vergleichende Analyse mit
dem heutigen Bestand sowie für weitergehende Interpre-
tationen der bauhistorischen Befunde und archivalischen
Hinweise. So liefern sie letztlich auch wichtige Informationen
für die zeichnerische Darstellung zu den wesentlichen Stufen
der baulichen Entwicklung in Form einer sogenannten
Baualterskartierung.
Abb. 1
Ausschnitt aus dem
„Plan von den Kloster
Marienberg vor Helmstedt,
nebst denen Environs“
, auf
genommen von Johann Martin
Schüttelöffel, 1787 – hier:
Kirche und Klausur.
Der nördliche Gebäudeflügel
hier: Hauptflügel und Ansatz
des Küchenbaus, 2011.

